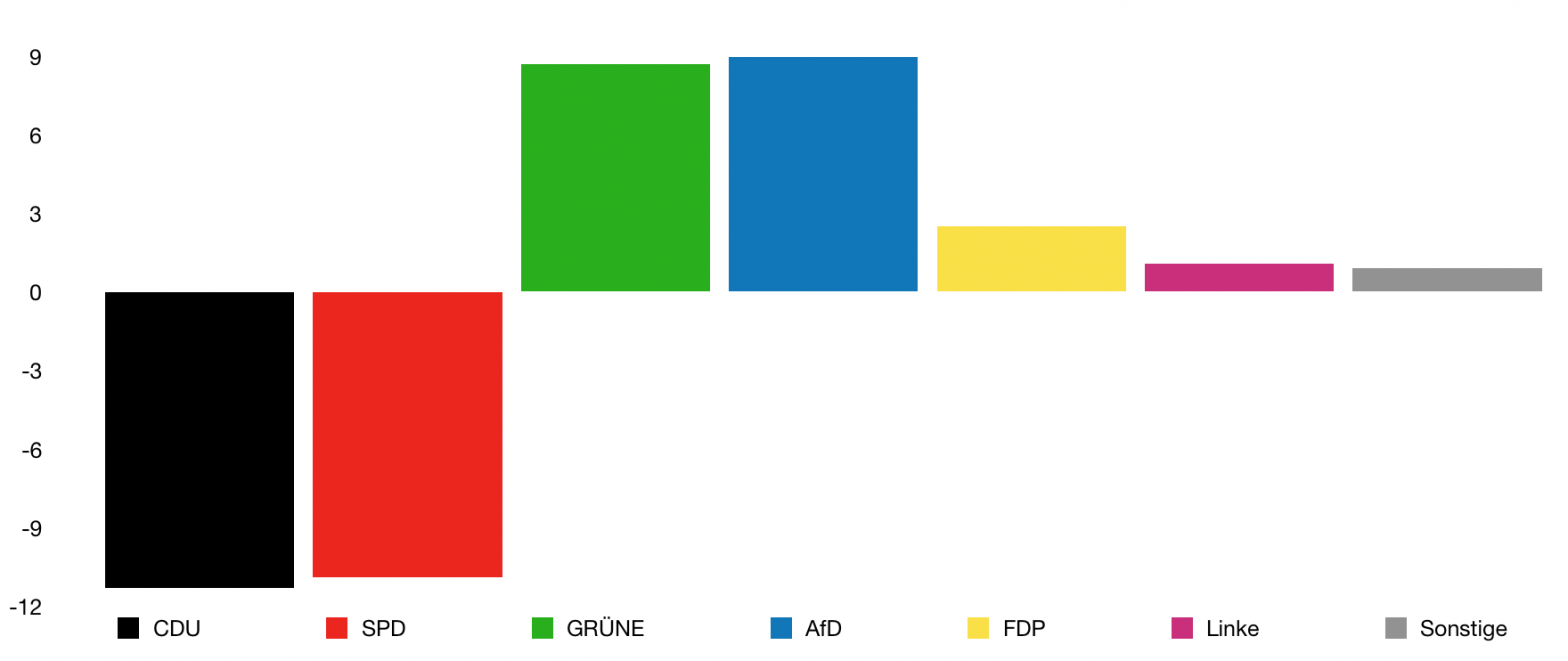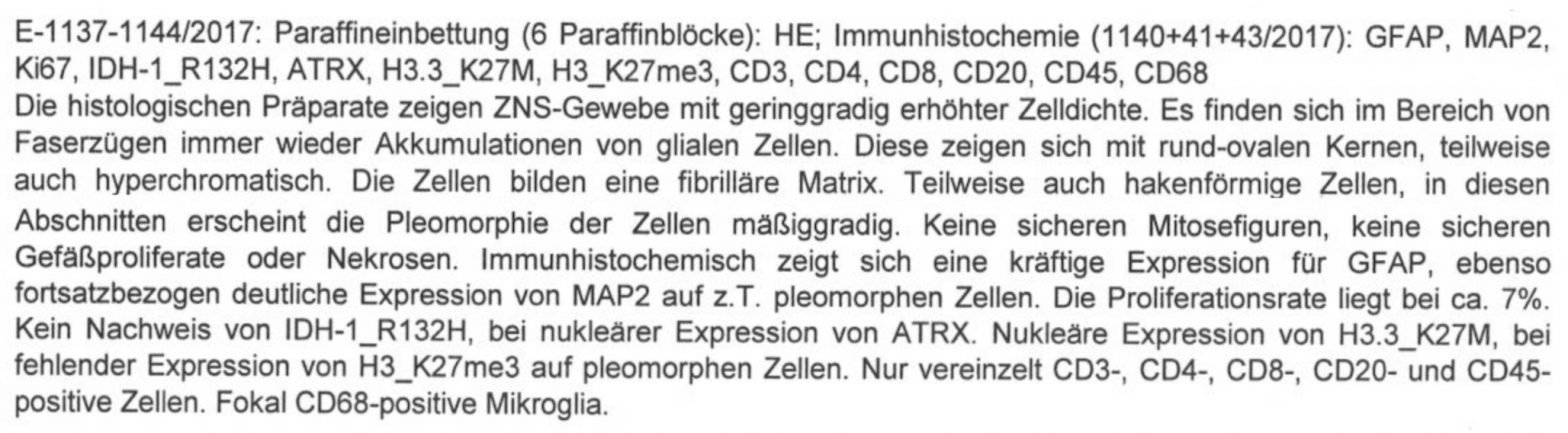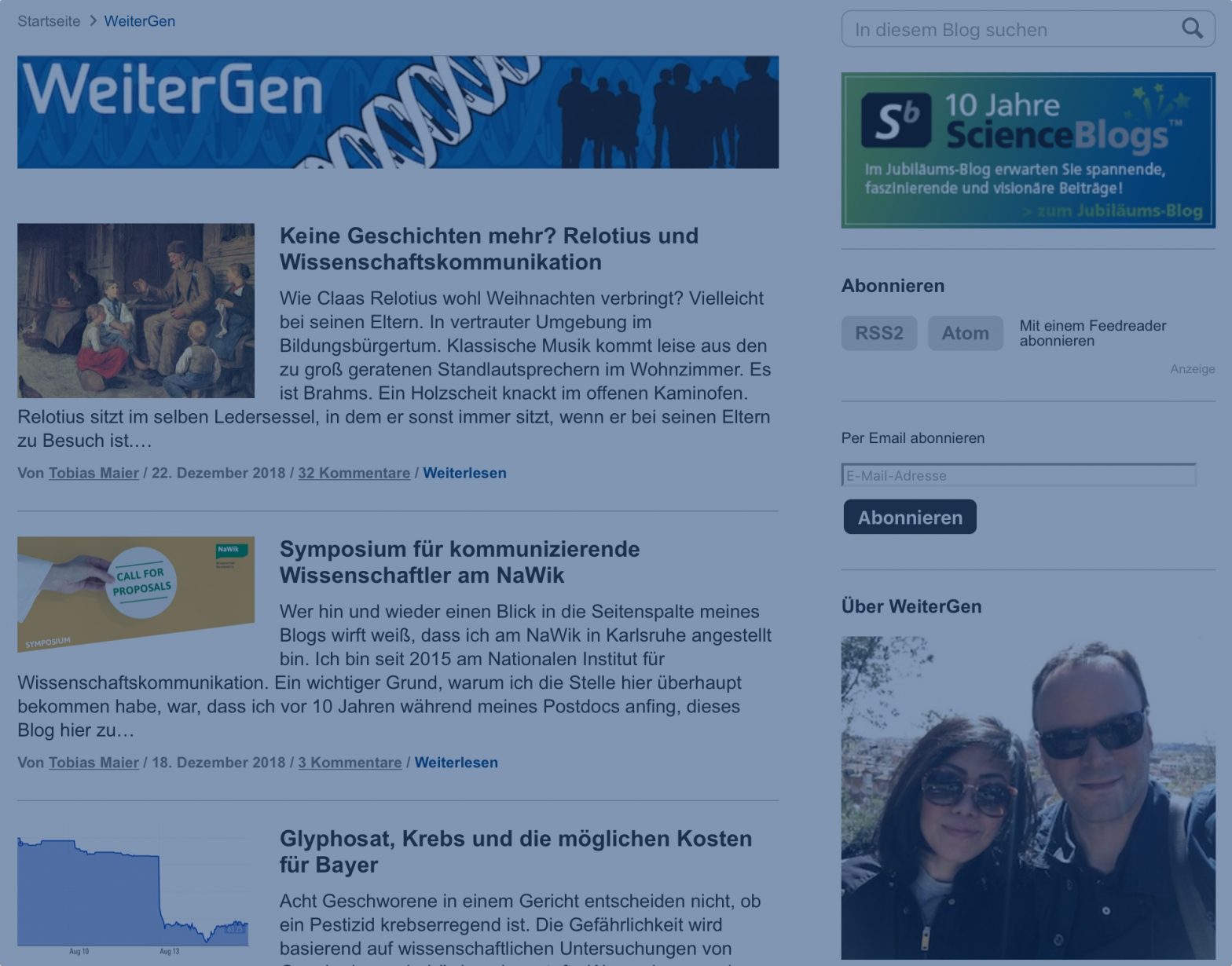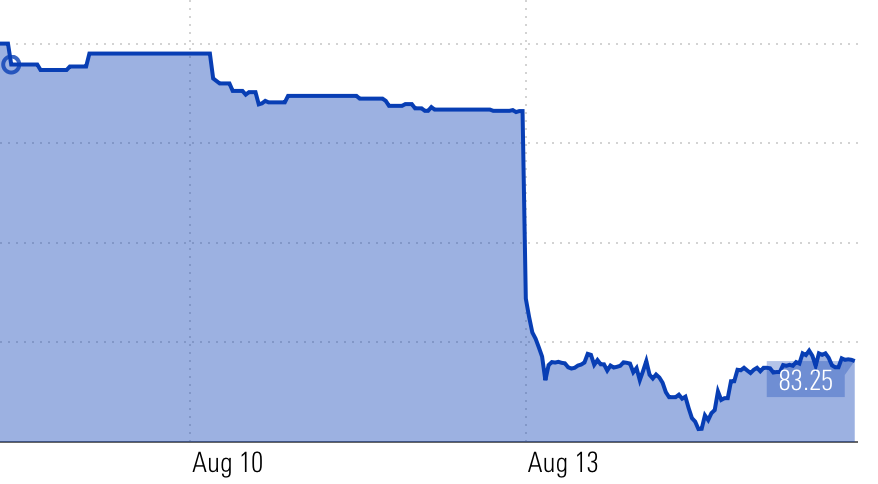Die Plattform Wissenschaftskommunikation.de ist eine super Sache! Nicht umsonst ist mein Arbeitgeber Partner bei dem Projekt. Auf der Plattform werden die verschiedensten Kommunikationsformate akribisch gesammelt und organisiert. Es gibt Beiträge zur Forschung, der Science of Science Communication, und es gibt Seiten zur Arbeitswelt mit Profilen von Menschen, die Wissenschaft kommunizieren: Wissenschaftsjournalisten, Angestellte von Kommunikationsabteilungen und Pressestellen an Forschungsinstituten, freiberufliche Kommunikatoren und die eine oder den anderen Wissenschaftler.
Die Seite hat außerdem den Anspruch, aktuelle Ereignisse in der Wissenschaftskommunikation zu kommentieren. Gerne kontrovers, so wie sich das für ein zünftiges Blog gehört. So geschehen dann auch letzten Donnerstag von der Journalistin Heidi Blattmann zu den Siggener Impulsen 2018.
Frau Blattmann ist bei ihrer inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Papier [pdf] leider nicht über die Fußnote der ersten Seite hinaus gekommen. Dafür macht sie ein anderes, altes Fass auf.
Ist der Wissenschaftsjournalismus Teil der Wissenschaftskommunikation oder muss er sich davon abgrenzen? Man fühlt sich beim Lesen ihres Artikels in das Jahr 2014 zurück versetzt, als die Gefechte um die Definition des Begriffs Wissenschaftskommunikation gefühlt ihren Höhepunkt erreicht hatten.
An ihr und an anderen Haudegen der Branche sind die Diskussionen von damals offenbar weitgehend wirkungsfrei vorbei gegangen. Deshalb wittert Frau Blattmann gleich eine Verschwörung der Wissenschafts-PR wenn sie anmerkt, dass die Wikipedia Seite zur Wissenschaftskommunikation Anfang Oktober 2018 ganz plötzlich umgeschrieben worden sei – mit eben jener neumodischen Definition von Wissenschaftskommunikation, die den Journalismus mit einbezieht – und die ihr aufstößt.
Niemand will den Wissenschaftsjournalismus vereinnahmen oder dessen Unabhängigkeit in Frage stellen. Alle sind sich der besonderen Rolle des Journalismus bewusst. Woher kommt dann der Wunsch der Journalistin, ihren Beruf von dem allgemeinen Begriff Wissenschaftskommunikation abzugrenzen? Josef König liefert eine mögliche Antwort auf die Frage in einem Kommentar unter einem Artikel von Markus Pössel (der übrigens Hauptautor des Wikipedia-Artikels zur Wissenschaftskommunikation ist). Josef König schreibt da:
Ich bin seit ca. 30 Jahren in der Hochschulpresse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig und mit dem idw deutlich auch darüber hinaus. Ich glaube, dass ich die Vorbehalte gut erkenne. Für mich stellt sich die Entwicklung so dar, dass in dieser Zeit die PR-Leute als nicht kompetent und als keine geeigneten Gesprächspartner von Wissenschaftsjournalisten angesehen wurden. Der neuen Begriff Wisskomm kommt mir daher wie ein „Kampbegriff“ gegen diese Sicht der Wissenschaftsjournalisten vor, und seine „Perfidie“ liegt darin begründet, dass er sie gleichsam eingemeindet und somit die klare Rollentrennung verwischt.
Geht es also um Eitelkeit und die Standesdünkel der guten alten Zeit der journalistischen Deutungshoheit von damals?
Heute suchen alle nach Möglichkeiten, den Wissenschaftsjournalismus nachhaltig zu finanzieren und gleichzeitig dessen Unabhängigkeit zu gewährleisten. Übrigens auch Thema des Siggener Impulspapiers. Auf Seite vier und auf Seite sieben.Wichtiger als alte Wortdefinitions-Grabenkämpfe, wie ich finde.
Titelbild: Theodoor Verstraete – Frühling in Shoore (Zeeland). Public Domain Lizenz