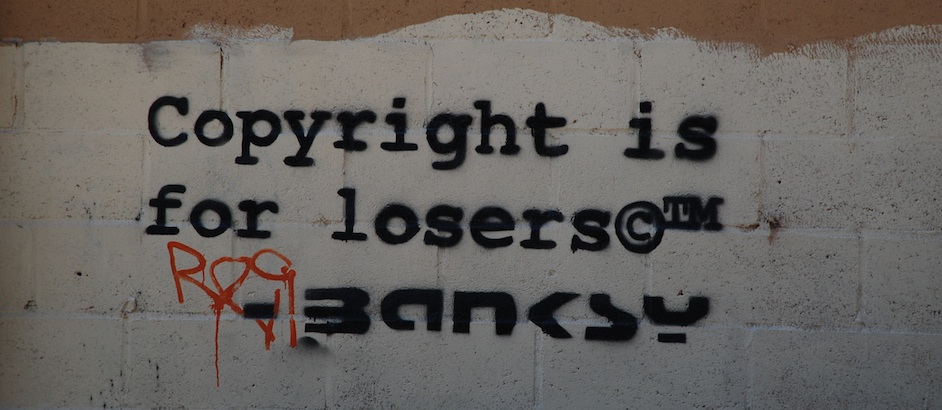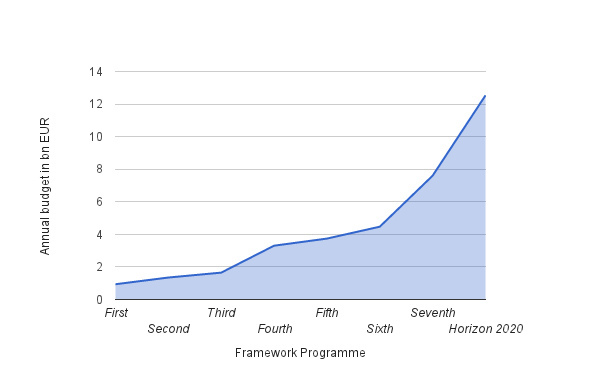Heute findet die diesjährige Preisverleihung der Nobelpreise statt. Ab kurz vor eins sollte hier der die Liveübertragung der Vergabe des Friedensnobelpreises in Oslo zu sehen sein und ab zwanzig nach vier sollten dann auch die Naturwissenschaftler in Stockholm ihre Medaillen und Urkunden entgegen nehmen dürfen.
„for their discoveries of machinery regulating vesicle traffic, a major transport system in our cells.”
Hier ist der Link zu Scheckmans 54 minütigem Vortrag den er am 7.12. am Karolinska-Institut hielt. Für diejenigen, die sich näher mit der Thematik befassen wollen oder einen historischen Überblick über das Feld bekommen möchten.
Wissenschaftler stehen ja nur selten im öffentlichen Rampenlicht. Die Verleihung der Nobelpreise ist jedoch eine der Ausnahmen und Randy Schekman nutzt die momentane Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wird, um in einem Artikel im Guardian Open Access zu propagieren und explizit die von ihm so gekannten Luxusmagazine Cell, Nature und Science, sowie den Impact Factor im Allgemeinen zu kritisieren. Insbesondere geht es ihm um den negativen Einfluss, den die hochselektiven Magazine auf den generellen Wissenschaftsbetrieb haben:
Luxury-journal editors […] accept papers that will make waves because they explore sexy subjects or make challenging claims. This influences the science that scientists do. It builds bubbles in fashionable fields where researchers can make the bold claims these journals want, while discouraging other important work […].
Scheckman erklärt weiter, wie Open-Access Magazine (wie das von ihm co-herausgegebene eLife Journal) den kostenfreien Zugang zu wissenschaftlichen Literatur erlauben und unter Einhaltung aller notwendigen Qualitätskriterien fairer publizieren, da sie eine größere Anzahl an Artikeln veröffentlichen können als die Luxusmagazine und nicht auf Abonnenteneinnahmen angewiesen sind.
Obwohl aktuell bereits etwa 20% der biomedizinischen Fachliteratur frei zugänglich sind, vollzieht sich der Kurswechsel hin zu offenen Modellen zu langsam – und stößt an Grenzen. Ein Artikel in einem „Luxusmagazin“ wird in den Köpfen der Wissenschaftler immer noch mit hoher Qualität gleichgesetzt. Einer aktuellen Umfrage der Nature Publishing Group zur Folge, sind es demnach immer noch das Prestige des Magazins, sowie der Impactfaktor, die neben der fachlichen Relevanz entscheiden, an welches Magazin das eigene Manuskript geschickt wird.
Weiter werden in den Auswahlkriterien der Forschungfinanzierer und der Berufungskommissionen viel Wert auf Publikationen in Luxusmagazinen gelegt. Ein Erstautorenpaper in Cell, Nature oder Science ist in meiner Erfahrung immer noch fast so etwas wie eine Garantie für das berufliche Weiterkommen auf der akademischen Karriereleiter. Es zählt der Name mehr als die Inhalte.
Es ist daher leider immer noch eine Luxusposition, die der Nobelpreisträger Schekman einnimmt, wenn er sagt, dass sein Labor die Luxusmagazine boykottiere und seine Mitarbeiter ihre Manuskripte woanders einreichen würden. Es ist eine Luxusposition, die ihm nach 46 eigenen Artikeln in Cell, Nature und Science nichts mehr anhaben wird, die einigen Postdocs in seinem Labor aber die Karriere kosten kann.