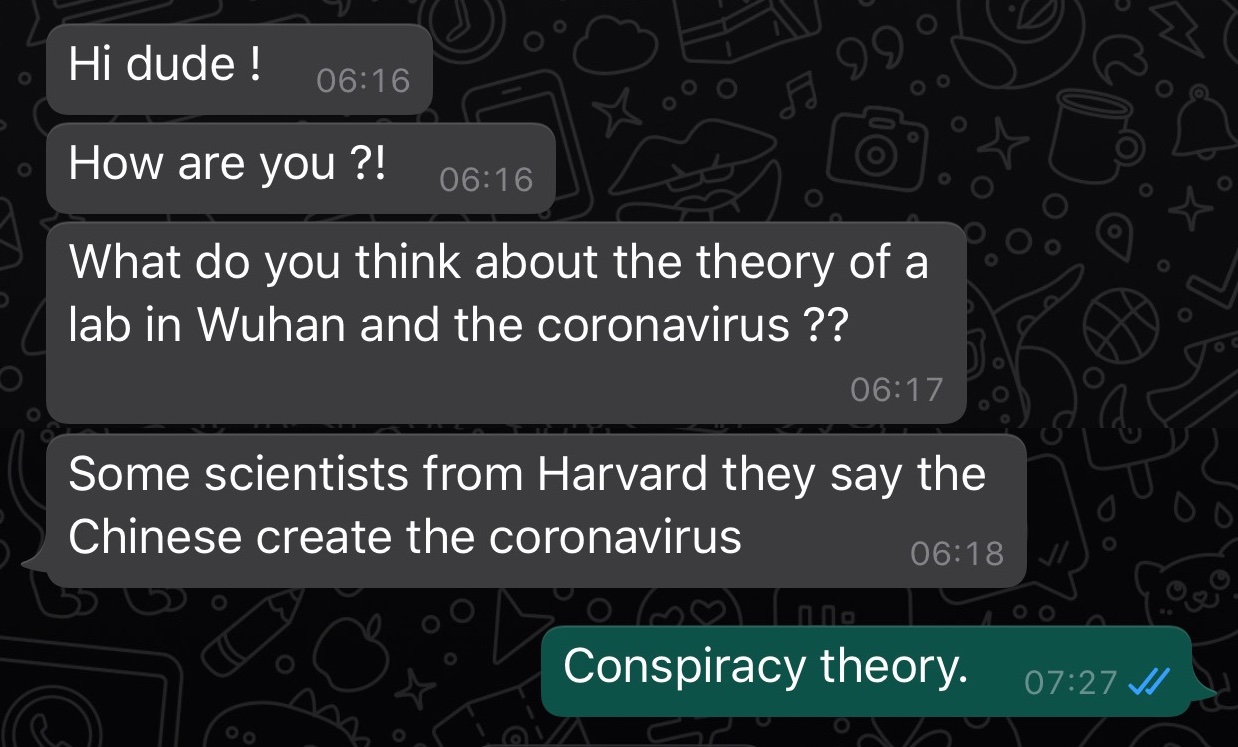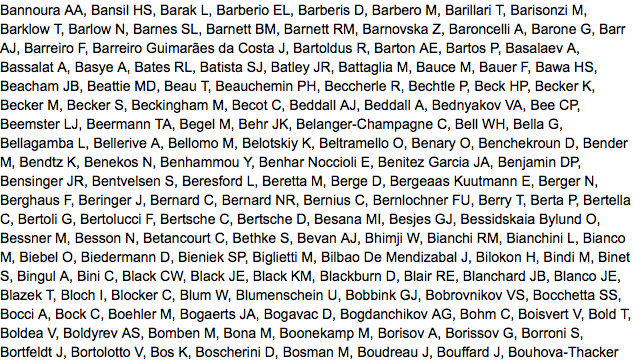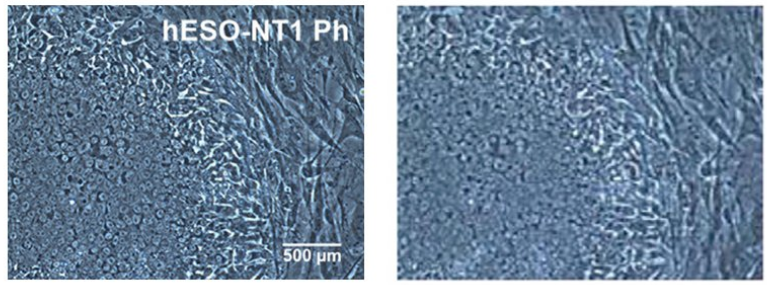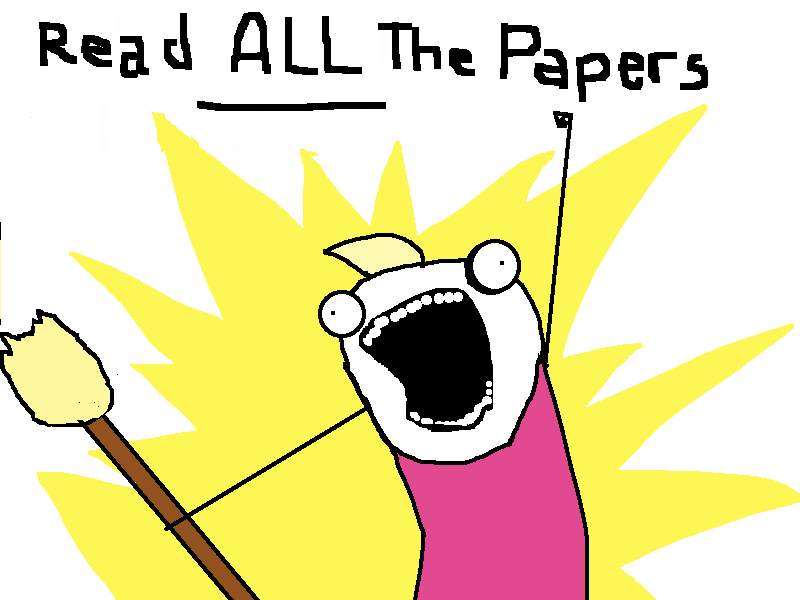Warum sind es eigentlich immer die Köche? Ein vorher mir gänzlich unbekannter Modekoch namens Attila Hildmann erreicht gerade traurige Berühmtheit durch das Verbreiten kruder Verschwörungstheorien rund um Covid-19. Mein Freund Giancarlo wohnt in Doha, ist Leibkoch eines katarischen Prinzen, und schickt mir regelmäßig über WhatsApp die jüngsten Nachrichten aus Verschwöristan.
Es sind nicht nur die Köche. In Großbritannien, einem Land, in dem ja sonst bekanntermaßen rational entschieden wird, glauben offenbar 60% aller Einwohner an Verschwörungstheorien. Schon vor Covid.
Welche Faktoren führen dazu, dass Menschen an Verschwörungstheorien glauben?
Verschwörungstheorien bedienen sozialpsychologische Wünsche bei ihren Jüngern, schreiben Douglas et al. in ihrem Übersichtsartikel. Wenn diese Wünsche von Verschwörungstheorien eher gedeckt werden als von der schnöden Realität, dann wird die Alternative bereitwillig angenommen und verbreitet. Die Autoren unterteilen die Gründe für die Empfänglichkeit für Verschwörungstheorien in drei Bereiche: Epistemische, existenzielle und soziale Motive.
Epistemische Motive meint: Einfache, in sich logische Erklärungen und Bestätigungen für das was man sowieso schon glaubt (zu wissen). Existenzielle Motive meint: Keinen Einfuss zu haben auf die Umgebung und Kontrolle zu verlieren. Insbesondere wenn es keine klare, offizielle Erklärungen gibt und man sich selbst unsicher fühlt. Soziale Motive meint: Den Wunsch ein positives Selbstbild oder ein positives Image der eigenen Gruppe zu wahren. Der Glaube an Verschwörungstheorien ist unter Narzissten weiter verbreitet und in Gruppen, die sich marginalisiert oder auf der Verliererseite fühlen.
Es scheint, als Böte die Corona-Krise einen idealen Nährboden für Verschwörungstheorien. Es gibt keine einfachen Erklärungen für das was gerade passiert, die Unsicherheit ist hoch, Kontrolle wird abgegeben und es ist naheliegend, sich auf der Verliererseite zu wähnen.
Der wahrgenommene Anstieg an Verschwörungstheorien ist möglicherweise keine reine Corona-Modeerscheinung, die so schnell wieder verschwinden wird wie die selbst geschneiderten Masken. Die Forschung zeigt: Verschwörungstheorien erodieren Sozialkapital und führen zu Misstrauen gegenüber Institutionen im Allgemeinen und der Wissenschaft im Besonderen.
Ich frage mich, was man dagegen tun kann? Reicht es aus, weiter beharrlich zu erklären, wie Wissenschaft funktioniert? Werden die “Vertrauensfaktoren” Eigene Expertise, Ehrlichkeit, und gute Absichten von Aluhüten überhaupt anerkannt?
Zumindest die “Schwer erreichbaren Zielgruppen” sollten in den Fokus gerückt werden. Denn der Glaube an Verschwärungsthorien sei weiter verbreitet bei Menschen mit weniger ausgeprägtem analytischen Denken und einem niedrigeren Bildungsstand.