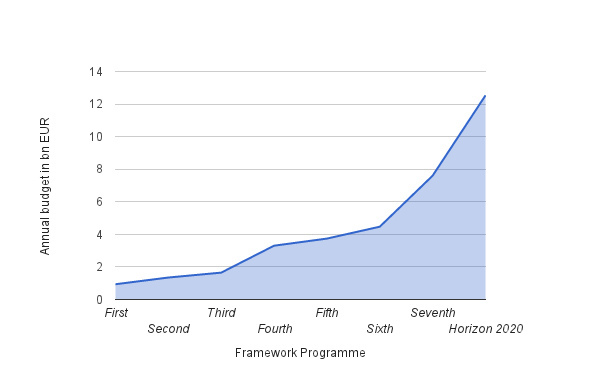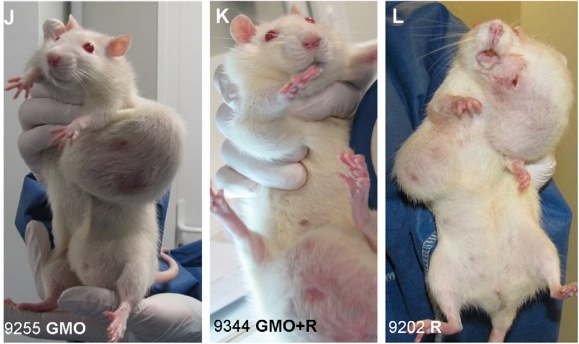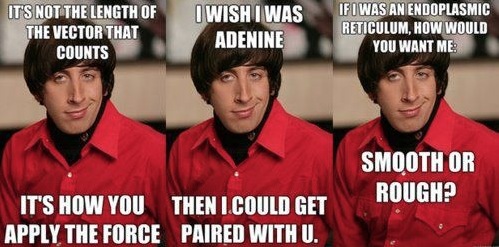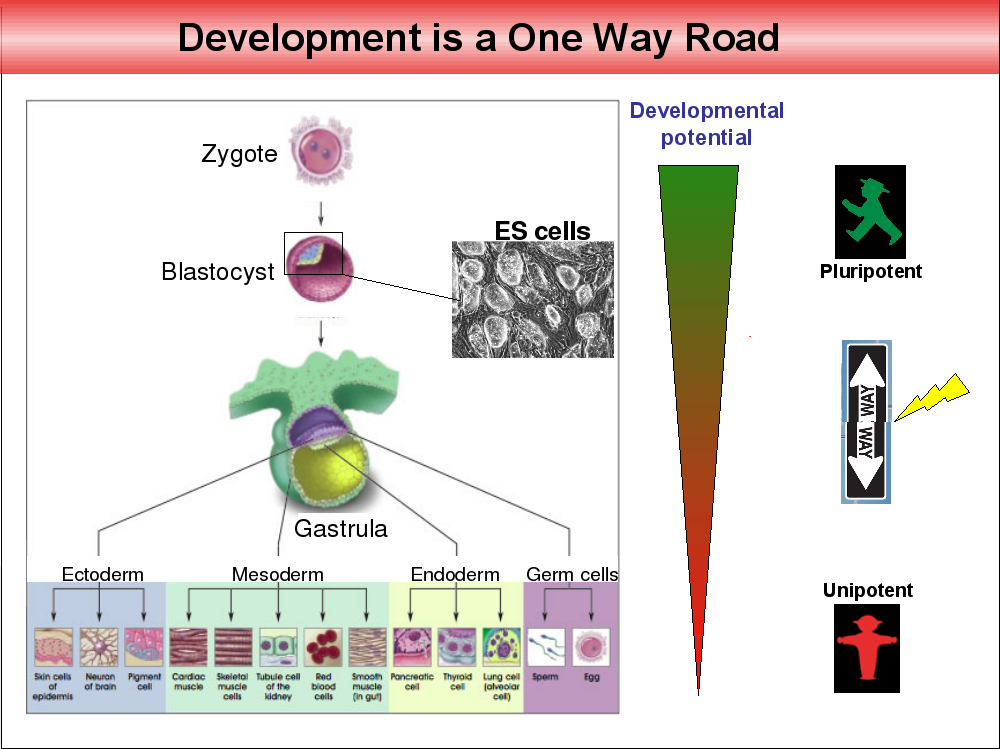Wissenschaftliche Forschung an Universitäten und öffentlichen Instituten wird im Allgemeinen durch öffentliche Gelder finanziert. Der Weg von der Idee zum finanziell geförderten Forschungsprojekt ist jedoch mühsam, langwierig und frustrierend. Anträge müssen geschrieben und revidiert werden, vorläufige Ergebnisse müssen präsentiert werden, formale Richtlinien und Deadlines müssen eingehalten werden. Das ganze dauert oft noch länger als später das publizieren der Ergebnisse. Wäre es nicht toll, wenn es alternative Pfade zu den gängigen Wegen im Förderjungel aus Institutsetats, DFG-Anträgen, BMBF-Mitteln und EU-Projekten gäbe?
Gibt es seit ein paar Tagen auch in Deutschland, heißt Sciencestarter, und ist eine Crowdsourcing-Plattform nach dem überaus erfolgreichen Vorbild Kickstarter. Doch ob das funktioniert, ist eher zweifelhaft.
Wissenschaftliche Projekte unterschieden sich in einem ganz grundsätzlichen Aspekt von den Projekten die auf Kickstarter erfolgreich finanziert werden: Dort gibt es einen realen Gegenwert für den eingesetzten Betrag. Ganz gleich ob es sich um Comicbücher, Filme über Frauenrechte, Schlüsselanhänger, iPhone-Hüllen oder Musikalben handelt. Das eingesetze Geld ist eine Investition, die einem Kauf gleich kommt. Bei Erreichen des Finanzierungsziels kann man sich als Gegenleistung das Album oder den Film herunterladen oder bekommt das Buch, den Anhänger oder die iPhonehülle zugeschickt.
Das eingesetzte Geld für wissenschaftliche Projekte – ob auf der deutschen Sciencestarter oder den Vorbildern petridish, Microryza und SciFund kommt hingegen Spenden gleich. Wissenschaftliche Grundlagenforschung stellt nunmal keine Produkte her und Fotos von Artgeschützen Tieren, Einladungen zu Labmeetings oder in Kunstharz eingegossener Pferdemist, wie er bei einem der derzeit sechs geförderten Projekten auf der deutschen Sciencestarter Seite für 500 Euro Spendenvolumen angeboten wird, sind symbolische Gegenleistungen.
Wer spendet also für Crowdfundingprojekte mit wissenschftlichem Hintergrund? Es ist wohl weniger die wissenschaftsinteressierte und spendenfreudige Öffentlichkeit als vielmehr Verwandte, Freunde und Bekannte, wie eine entsprechende Auswertung des Wissenschafts-Crowdsourcing-Referenzprojekt von Ethan Perlstein ergab. Perlstein hat hat erfolgreich 25 000 Dollar zur Erforschung des Wirkmechanismus von Amphetaminen eingeworben. Eine Analyse seines Facebook-Netzwerks ergab, das rund 10% der mit ihm verbundenen Freunde gespendet haben. Der größte Spender war offenbar sein Großvater Walter. Perlstein selbst schreibt:
Friends and family are the first stop on the crowdfunding whistle stop tour!
Die Macher von Sciencestarter.de wissen natürlich auch, dass eher der Wunsch als ein realistisch erreichbarer Finanzierungserfolg für Forschungsprojekte bei der Konzeption der Seite Pate stand. Die von der Wissenschaftskommunikationsinititative Wissenschaft im Dialog gegründete und vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft unterstützte Plattform legt daher auch Wert darauf, den kommunikativen Mehrwert von Sciencestarter zu vedeutlichen:
Mit der Plattform stellt Wissenschaft im Dialog auch ein neues multimediales Werkzeug für die Wissenschaftskommunikation zur Verfügung. Die Öffentlichkeit erlebt Wissenschaft als Prozess und kann diesen unmittelbar mitgestalten.
Folglich sind auf Sciencestarter auch explizit Wissenschaftskommunikationsprojekte erwünscht:
Sciencestarter ist die deutschsprachige Crowdfunding-Plattform zur Finanzierung von Projekten aus Wissenschaft, Forschung und Wissenschaftskommunikation. Forscher, Studenten und Wissenschaftskommunikatoren können hier ihre Projekte durch viele einzelne Personen finanzieren lassen.
Ich hätte da schon eine Idee. Wie wäre es mit einer crowdgefundenen Wissenschaftsblogplattform? Für 2500 Euro Startkapital sollte man eine moderne und technisch funktionierende Blogplattform einrichten können, die sämtliche technische Probleme, wie nicht funktionierende Plugins, fehlende Kommentarvorschau und Editierfunktion und mangelhafte Darstellung auf mobilen Geräten löst. Darüberhinaus eingenommenes Kapital käme direkt den Bloggern zu Gute. Wer ab 25 EUR spendet bekäme ein eigenes Profilbild und kann die Kommentarvorschau und Editierfunktion nutzen. Wer ab 100 EUR spendet, würde aus der Seitenspalte verlinkt, für 250 Euro gäbe es einen Gastbeitrag eines Wissenschaftsbloggers auf der eigenen Seite zu einem Thema nach Wahl,…