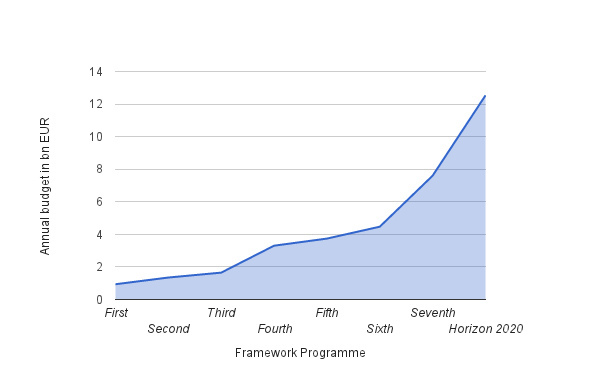In den USA werden verurteilte Kriminelle die für die Gesellschaft keine direkte Gefahr darstellen gerne mit elektronischen Fußfesseln überwacht. Die Fußfesseln entlasten die chronisch überbelegten Gefängnisse und kosten den Steuerzahler weniger als eine Unterbringung im Knast. Außerdem ermöglichen sie, die so markierten Straftäter jederzeit zu orten. Falls ein Täter sich zu weit von zu Hause entfernt, wird Alarm geschlagen. Eine Variante ermöglicht auch die Durchsetzung von Unterlassungsbefehlen. Alarm wird dann ausgelöst, wenn sich der Täter bestimmten Gebäuden oder Einrichtungen nährt.
Unser ehemaliger Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg ist, nachdem er in Deutschland als Plagiator überführt wurde, in die USA ausgewandert. Er hat sich im malerischen Greenwich (Connecticut) ein Haus gekauft und ist dort, nördlich von New York, eigenen Angaben zur Folge, sehr glücklich. Neben dem Plan, sich um seine Familie zu kümmern, ein Buch zu schreiben und den ein oder anderen Neuenglandhummer zu verdrücken, nimmt der Politiker der Reserve offenbar auch einige lokale Termine wahr. Letzte Woche stand ein Vortrag in Yale an, einer Universität an der amerikanischen Ostküste mit einem hervorragendem wissenschaftlichen Ruf. Es sollte laut Spiegel online um „Mythen der transatlantischen Beziehungen gehen“.
Einige Doktoranden empfanden die Einladung des überführten Plagiators an die Eliteuniversität offenbar nicht angemessen. Sie riefen zu einem Protest für „akademische Integrität“ auf und verließen demonstrativ den Seminarraum, als der CSU-Politiker anfing zu sprechen (sic). Während Guttenberg an eine akademische Einrichtung, also den Ort seines Vergehens zurück kehrte, ersetzten die demonstrierenden Doktoranden so die elektronische Fußfessel. Zumindest dieser Kontrollmechanismus scheint zu funktionieren.
Obwohl langsam die promovierten Politiker auszugehen scheinen, erfreut sich das identifizieren von plagiierten Stellen in Doktorarbeiten von Personen mit öffentlichen Funktionen weiterhin großer Beliebtheit. Ein Grund mag sein, dass es für dritte relativ einfach ist, Plagiate aufzuspüren. Um das Vergehen Guttenberg und Consorten in einem etwas größeren Rahmen einzuordnen, hier eingebunden eine Darstellung der neun Kreise der Wissenschaftshölle. Die Grafik ist angelehnt an Dantes Inferno und so original mit Erklärungen 2010 im Neuroskeptic Blog erschienen. Der Blogpost wurde jetzt in „Perspectives on Psychological Science“, einem peer-reviewten Magazin, erneut veröffentlich (.pdf).
Guttenberg selbst wird gar nicht die Chance haben, alle Kreise der Hölle zu durchlaufen. Dazu hätte er ja eigene Daten haben müssen. Um auf dem Laufenden zu bleiben, was sich sonst gerade im Fegefeuer tut, empfiehlt sich außerdem der Retraction Watch Blog.